Synodalität bewirkt Kulturwandel - Demokratie braucht Beteiligung aller
Presseerklärungen der Österreichischen Bischofskonferenz bei der Sommervollversammlung in Mariazell
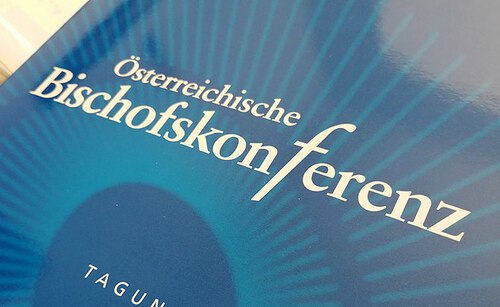
Wir dokumentieren hier den Wortlaut der Presseerklärungen der Österreichischen Bischofskonferenz bei der Sommervollversammlung in Mariazell von 10. bis 12. Juni 2024
1. Synodalität bewirkt Kulturwandel in der Kirche
Der von Papst Franziskus initiierte weltweite Synodale Prozess wird in Österreich mit Dankbarkeit und Engagement aufgenommen und hat einen positiven Kulturwandel in der Kirche hierzulande und auf weltkirchlicher Ebene bewirkt. Das ist eines der Ergebnisse des jüngst veröffentlichten Österreich-Berichts, der von der Bischofskonferenz in Auftrag gegeben wurde und fristgerecht am 15. Mai an das vatikanische Synodensekretariat ergangen ist. Auf Basis der Eingaben aus der ganzen Welt wird derzeit das Arbeitsdokument ("Instrumentum laboris") für die zweite Generalversammlung der Bischofssynode erstellt, die im Oktober im Vatikan stattfinden wird. Aus Österreich werden mit Stimmrecht der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, und Kardinal Christoph Schönborn daran teilnehmen. Zuvor wird von 29. bis 31. August ein internationales Treffen stattfinden, zu dem die stimmberechtigten Mitglieder sowie die Experten und Moderatoren der Bischofssynode aus Europa eingeladen sind. Aus Österreich werden Erzbischof Lackner sowie die Linzer Pastoraltheologin Prof. Klara Csiszar dabei sein.
Der Österreich-Bericht war Ausgangspunkt der Beratungen der Bischöfe in Mariazell über Synodalität. Er ist kein Forderungskatalog der Bischofskonferenz, sondern bietet eine komprimierte Zusammenfassung der vertiefenden Gespräche zum Synthese-Bericht der Weltsynode, die in qualifizierten Foren und Gremien in Österreich in den letzten Monaten stattgefunden haben. Dabei wurden insgesamt 14 Themenfelder als vordringlich identifiziert. Die Stellung der Frau in der Kirche, die missionarische Ausrichtung der Kirche und mehr innerkirchliche Partizipation wurde dabei als prioritär qualifiziert.
Die österreichischen Bischöfe danken allen, die sich an den verschiedenen Phasen des Synodalen Prozesses beteiligt haben, der schon im Oktober 2021 begonnen hat. Der aktuelle Österreich-Bericht zeichnet ein getreues Bild davon, das von den Bischöfen geschätzt und mitgetragen wird. Gleichzeitig fällt auf, dass innerkirchliche Themen vorherrschend sind und noch zu wenig die gesellschaftliche Verantwortung von Gläubigen und das Gespräch mit Menschen außerhalb des kirchlichen Binnenraumes wahrgenommen werden.
Besonders bewährt hat sich die immer öfter praktizierte Methode des "synodalen Gesprächs im Heiligen Geist", wie sie in diversen "Anhörkreisen" oder bei der Bischofssynode im vergangenen Herbst in Rom eingeübt wurde. Dabei geht es um eine Kultur des offenen Sprechens sowie des Hörens aufeinander und auf das, was Gott uns heute sagen will. In dieser Haltung steckt viel positive Energie, weil sie die Gesprächskultur verändert und daher Vielfalt und Unterschiedlichkeit in den Positionen leichter lebbar macht. Es wäre sehr viel gewonnen, wenn diese Haltung zu einer Selbstverständlichkeit in der Kirche wird und auf die Gesellschaft ausstrahlt. Die österreichischen Bischöfe sind davon überzeugt: Synodalität stärkt das Miteinander und eröffnet einen geistlichen Raum, in dem gemeinsame Entscheidungen reifen können.
2. Demokratie braucht die Beteiligung aller
Mit der erfolgten Wahl zum Europäischen Parlament und den bevorstehenden Nationalratswahlen am 29. September stehen weitreichende politische Entscheidungen für Österreich und Europa an. Im Vorfeld der Europawahlen haben die österreichischen Bischöfe die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihr Stimmrecht auszuüben, um damit Europa konstruktiv mitzugestalten und die Demokratie zu stärken. Das Ergebnis dieser Wahl zeigt in Österreich einen spürbaren Rückgang der Wahlbeteiligung. Das ist beunruhigend und sollte ein Weckruf für alle politisch Verantwortlichen im Land sein.
Schon seit Jahrzehnten geben die katholischen Bischöfe in Österreich keine konkreten parteipolitischen Wahlempfehlungen, sondern benennen Themen und Prinzipien, die eine Orientierungshilfe für Wahlberechtigte sein sollen. Aus diesem Grund wird auch keine der derzeit im Parlament vertretenen Parteien pauschal empfohlen oder vor ihr gewarnt. Die Bischofskonferenz ist mit allen maßgeblichen Parteien in einem regelmäßigen Dialog.
Für die Beurteilung politischer Parteien durch die Wahlberechtigten sind das Programm, die konkrete Praxis und leitenden Personen der betreffenden Partei im Blick auf christliche Werte, die Menschenrechte und die rechtsstaatlichen Prinzipien unserer Demokratie maßgeblich. Wo es zu gravierenden Verstößen gegen die Fundamente für ein friedliches Zusammenleben kommt, treten auch die Bischöfe ganz konkret dagegen auf, was immer wieder geschehen ist. Rote Linien werden etwa überschritten in Fällen von Antisemitismus, wenn die Religionsfreiheit verletzt wird oder wenn das Leben von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Ende nicht ausreichend geschützt wird.
Eine mangelnde Wahlbeteiligung kann Ausdruck von Protest, aber auch von Misstrauen oder Verdrossenheit gegenüber der Politik sein. Ernsthafte Demokraten dürfen sich damit nicht abfinden. Es muss allen politischen Kräften in erster Linie darum gehen, das Vertrauen in die demokratische Grundordnung zu stärken. Eine Nagelprobe dafür sind Wahlauseinandersetzungen. Vor diesem Hintergrund plädieren wir Bischöfe an alle wahlwerbenden Parteien für einen respektvollen Umgang, faktenbasierte Diskussionen und die Vermeidung populistischer Kommunikationsstrategien.
Anstelle persönlicher Angriffe und diffamierender Äußerungen soll der Fokus auf der Darlegung unterschiedlicher politischer Standpunkte und konstruktiver inhaltlicher Kritik liegen. Es braucht eine sachliche, faktenbasierte Argumentation statt reiner Polemik, unbelegter Behauptungen sowie irreführender Informationen, um den Wahlberechtigten eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen. Im Zentrum politischer Debatten sollen lösungsorientierte Ansätze stehen, anstatt Ängste und Vorurteile auszunutzen und einzelne Gruppen gegeneinander auszuspielen und zu diffamieren. Nur ein respektvoller Dialog, der Brücken baut, statt Gräben zu vertiefen, kann zu tragfähigen Kompromissen und zu einem friedlichen Miteinander führen. So wie alle gesellschaftlichen Akteure sind auch politische Parteien in ihrem öffentlichen Handeln auf das Gemeinwohl verpflichtet; dieses hat unbedingten Vorrang vor der Durchsetzung partikulärer Interessen.
Quelle: kathpress (12.06.2024)

